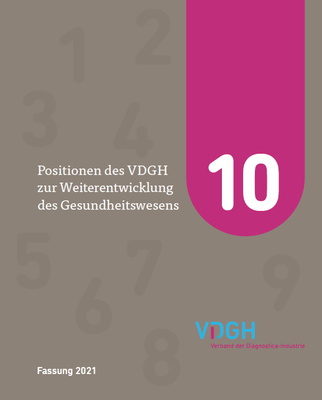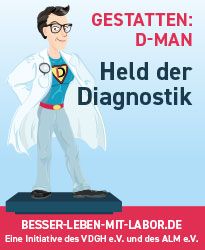VDGH
Verband der Diagnostica-Industrie e.V.
Neustädtische Kirchstr. 8
10117 Berlin
Telefon: 030 / 200 5 99-40
Telefax: 030 / 200 5 99-49
E-Mail: vdgh@vdgh.de
Stellungnahmen
Hier finden Sie Stellungnahmen des VDGH zu aktuellen Gesetzgebungsvorhaben.